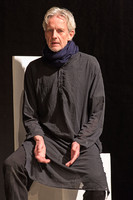Vergil und Augustus
Video nach einer filmischen Aufzeichnung von Manfred Bohnhoff
Das Stück „Vergil und Augustus“ darf als Vorweihnachtsgeschichte gelten, weil es 19 v. Chr. spielt, weil der Dichter Vergil in einer seiner Eklogen tatsächlich eine Erlöser-Vision beschrieben hat, und weil aus einer politisch und persönlich begründeten Verzweiflung heraus Hoffnung auf Erlösung gesetzt wird.
Das Stück schildert die letzten achtzehn Stunden des sterbenden Vergil. Es ist eine Auseinandersetzung des römischen Dichters mit der Richtigkeit und Unrichtigkeit seines Lebens, mit der Berechtigung und Nicht-Berechtigung seiner dichterischen Arbeit, der dieses Leben geweiht war, doch es enthält auch die Auseinandersetzung mit den geistigen und mystischen Strömungen, von denen das Römische Reich in diesem letzten vorchristlichen Jahrhundert geprägt war, und die Vergil zu einem Vorahner des Christentums gemacht haben. Nach jahrzehntelangen Bürgerkriegen hat Augustus die abendländische Zivilisationssphäre wieder befriedet und ihr zu neuer Prosperität verholfen. Bei aller politischen Gewandtheit, blieb der Kaiser jedoch einer reaktionären Haltung verhaftet und war darum keineswegs der Heilbringer, als den er selber sich gerne feiern ließ.
Es war eine Zeit der Religionsauflösung; der alte Glaube war nicht mehr tragfähig, asiatische Einflüsse gewannen an Boden, und die vielfach atheistisch gewordene Philosophie begünstigte den Auflösungsprozess. Vergil, der überragendste Geist seiner Zeit, ahnte, dass sich Neues vorbereite. In der völligen Vereinsamung seiner Sterbestunde begreift er die kommende Verkündigung als Notwendigkeit der Geschichte. In einer letzten Phantasie des Sterbenden werden rationales Denken und irrationales Empfinden zu einer magischen Einheit verquickt, die sich schließlich verklärend auflöst, um in die Ewigkeit einzugehen.
Das Stück ist ein Extrakt aus dem Roman „Der Tod des Vergil“ von Hermann Broch, geschrieben von 1936 – 1945, teilweise in Gestapohaft in Wien, überwiegend jedoch in amerikanischer Emigration. Das Leben am Rande des Konzentrationslagers ließ für Hermann Broch den Impuls zur metaphysischen Auseinandersetzung mit dem Tod immer stärker werden. Und obwohl er keine Hoffnung mehr hatte, mit Literatur den Geschehnisse eine andere Richtung geben zu können, begann er zum Zwecke der eigenen Wahrheitssuche mit der Arbeit an dem Werk, das er später „Der Tod des Vergil“ nennen sollte. Darüber hinaus setzt sich das Stück mit der Frage auseinander, wie man unter der Gefahr einer Diktatur der Freiheit des Einzelnen und dem Gebot der Menschlichkeit Rechnung tragen kann.
Das Stück setzt sich zusammen aus einem inneren Monolog Vergils und einem Dialog zwischen Vergil und Augustus. Entsprechend der Vorgabe von Hermann Broch wurde es als Symphonie angelegt, deren vier Sätze sich auf die vier Elemente beziehen, angefangen mit Wasser als Symbol der Ankunft, gefolgt von Feuer als Abstieg, dann Erde – Erwartung und schließlich Äther als Symbol der Heimkehr.